Nicht nur im öffentlichen Diskurs, auch in den Wohnzimmern vieler Familien wird über gesellschaftliche und politische Themen diskutiert. Nun scheint vor allem der Ukraine-Krieg die Gespräche zu dominieren, was gerade in russlanddeutschen Familien eine Zerreißprobe auslösen kann. Sei es durch die Urgroßeltern, die während des Zweiten Weltkrieges aus der Ukraine oder Russland vertrieben wurden, durch Verwandte oder Freund:innen, die noch in Russland oder der Ukraine leben oder durch die russische Sprache – irgendwie betrifft es einen dann doch. So divers die einzelnen Familiengeschichten und Verbindungen letztendlich auch sind, der Umgang mit dem Krieg scheint in vielen Familien die gleichen Konflikte auszulösen.
Die Menschen in den Volksrepubliken hätten verzweifelt um Russlands Hilfe gebeten, die NATO hätte Putin so lange provoziert, bis er reagieren musste, in der Ukraine würde ein Genozid stattfinden und überhaupt würden die Medien in Deutschland lügen und nur negativ über Russland berichten. Man könnte diese Liste mit Aussagen von Familienmitgliedern, die den eigenen Puls in die Höhe schnellen lassen, lange fortführen. Putins jahrelange Propaganda zeigt in diesen Tagen ihre Früchte, die russischen Staatsmedien werden mit voller Überzeugung reproduziert. Narrative sind soweit perfektioniert, dass sie auch bei denjenigen anschlagen, die seit Jahrzehnten schon in Deutschland leben, ihre mediale Heimat aber in der Russischen Föderation gelassen haben.
Unterschiedliche mediale und soziale Bezugspunkte
„Gespräche mit den Eltern sind schwierig geworden. Schon bei der Annexion der Krim oder in den letzten Jahren mit Corona. Eine Diskussion macht einfach so müde und ich weiß, dass ich ihre Meinung sowieso nicht ändern kann”, sagt Kristina. Sie ist Mitte 30, als Russlanddeutsche in Kasachstan geboren und erzählt, wie ihre Eltern den Krieg und die Berichterstattung wahrnehmen: „Meine Eltern sind nicht putinhörig. Sie sind sich bewusst, dass es auf russischer Seite viele Fake News und Propaganda gibt. Sie sind der Meinung, dass Medien im Westen das aber auf die gleiche Weise und mit voller Absicht betreiben. Aber wenn man jeden Tag russisches Fernsehen sieht, kommt man eben nicht drum rum, subtile Propaganda zu schlucken, auch wenn man meint, die ‚offensichtliche’ zu erkennen”, so Kristina.
Jurist und Antidiskriminierungscoach Sergej Prokopkin stellt durch seinen Austausch mit Menschen aus der Postost-Community fest: „Die Geschichten ähneln sich, aber es gibt verschiedene Schattierungen bei den Meinungen der Familien. Es gibt Familienmitglieder, die Putins Ansichten teilen und befürworten, es gibt andere, die eher auf Ignoranz setzen und es gibt solche, die sich nicht ganz sicher sind, inwieweit sie hinter welchen Positionen stehen”, so Prokopkin. „Migrantische Familien generell haben oft die Konstellation, dass Kinder und Eltern unterschiedliche mediale und soziale Bezugspunkte haben. Diese Unterschiede werden umso relevanter, je stärker der Kontrast ist”, erklärt Prof. Dr. Jannis Panagiotidis, Historiker und Experte für postsowjetische Migration in Deutschland.
Ähnliches erzählt Tina aus Passau: „Als ich die Nachrichten gelesen habe, war ich ziemlich aufgewühlt und habe meiner Mama geschrieben. Sie sagte, die Ukraine würde schon immer zu Russland gehören und wenn die Amerikaner gingen, wäre der Krieg vorbei. Es war ein heftiges Gespräch, bei dem sich meine Mutter angegriffen fühlte, weil ich Putin kritisierte. Wir wollten beide nicht, dass das Gespräch abdriftet und redeten über Katzen.“ Tina ist in Kasachstan geboren und hat russische und russlanddeutsche Vorfahren, ein Teil der Familie lebt in Luhansk, in der Ostukraine. Die 32-Jährige hat Angst, ihre Mutter zu besuchen, sagt sie: „Ich kann bei politischen Diskussionen nicht schweigen.”
Meine Eltern sind nicht putinhörig. Sie sind sich bewusst, dass es auf russischer Seite viele Fake News und Propaganda gibt. Sie sind der Meinung, dass Medien im Westen das aber auf die gleiche Weise und mit voller Absicht betreiben. Aber wenn man jeden Tag russisches Fernsehen sieht, kommt man eben nicht drum rum, subtile Propaganda zu schlucken, auch wenn man meint, die ‚offensichtliche’ zu erkennen
Stärkere politische Stimme der jungen Generation
Die Annexion der Krim 2014 verursachte einen ersten politischen Riss in vielen Familien. Das lauteste Argument damals, das viele Kinder vielleicht noch nicht einordnen konnten: „Die Krim hat schon immer zu Russland gehört.” In der jetzigen Situation gibt es aber einen großen Unterschied: „Die Kinder von damals sind heute junge Erwachsene, die ihre eigene legitime Position vertreten. Sie artikulieren sich anders und stärker, haben eine öffentliche und eben auch politische Stimme”, so Panagiotidis. Ein Grund, wieso es in den Familien nun heftiger knallt als noch Jahre zuvor.
Der akademische Background der zweiten Generation in Deutschland spielt ebenfalls eine Rolle: „Viele Russlanddeutsche sind mit dem Ziel nach Deutschland gegangen, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Unter diesen Kindern sind viele Erstakademiker:innen. Trotzdem können Teile der älteren Generation mit der Uni relativ wenig anfangen, weil sie dazu selbst keinen Zugang hatte. Das kann auch dazu führen, dass Kinder und Enkelkinder nicht ernst genommen werden, auch wenn sie das Angestrebte schließlich erreicht haben”, erklärt Panagiotidis. Der soziale Aufstieg der Kinder, welcher grundsätzlich ja stets angestrebt wurde, führt nun oftmals zur Distanzierung von der Familie – nicht selten begleitet von dem frustrierenden Gefühl, sich den Mund fusselig zu reden. Zwar hat man das Glück, nicht fliehen zu müssen und sich in Sicherheit mit dem Krieg auseinandersetzen zu können, trotzdem stößt man dabei oft an die eigenen emotionalen Grenzen.
Menschen auf der gesamten Welt solidarisieren sich mit der ukrainischen Bevölkerung und sind aktiv: Sie spenden, gehen auf Demonstrationen oder helfen den Ukrainer:innen, die nach ihrer Flucht in Deutschland angekommen sind. Auch die Kinder der Russlanddeutschen, die mittlerweile mehrere Jahrzehnte in Deutschland leben. Ihre Kinder sind in einer Demokratie aufgewachsen, haben demokratische Werte verinnerlicht und wissen diese zu schätzen. Für sie ist es unverständlich, wenn Außenstehende einen Angriffskrieg auf ein souveränes Land mit Propaganda rechtfertigen anstatt ihn mit Nachdruck zu kritisieren.
„Man fühlt sich direkt persönlich angegriffen, Machtlosigkeit und Überforderung setzen ein. Zudem können sich Scham und Schuldgefühle entwickeln, wenn wir uns mit einer Geschichte identifizieren, sie aber von der Familie abgelehnt wird. Wir verspüren den Druck und den Zwang, etwas dagegen zu tun”, so erklärt der Psychologe Arthur Bohlender, was bei einem Konflikt in der Familie mit uns passiert. Man hat den Drang, das Leid der ukrainischen Bevölkerung irgendwie zu mindern und zugleich Aufklärung in der Familie zu betreiben. Wie schafft man es, die eigenen Werte zu vertreten ohne sich gleichzeitig von der Familie zu distanzieren?
Bei einem Gespräch sollte man sich lieber auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Sie können uns dabei helfen, wieder zueinander zu finden, ohne die eigenen Prinzipien verwerfen zu müssen.
Kleine Ziele setzen
„Der Umgang mit so einem Thema hängt ganz vom Klima in der Familie ab. Man sollte sich zuerst fragen, ob die andere Seite überhaupt für eine Diskussion bereit ist”, sagt Prokopkin. Laut dem Antidiskriminierungscoach sollte man sich vom Vorhaben lösen, die Familie von der eigenen Meinung zu überzeugen: „Setzt lieber kleine Ziele. Zum Beispiel, dass am Ende alle sich darauf einigen, dass der Krieg scheiße ist.” Vor allem durch die eigene Familiengeschichte könne man versuchen, diese kleinen Ziele zu erreichen, sagt Prokopkin: „Es ist sinnvoll, die Beziehungsebene auszubauen. Als Familie ist man emotional verbunden und emotional voneinander abhängig, wir wollen ja gar nicht miteinander streiten.” Dabei sollten wir aber nicht nur versuchen, unsere eigenen Ziele zu erreichen, sondern den Eltern und Großeltern zuhören und sie ernst nehmen.
Russlanddeutsche Geschichten sind auch Vertreibungsgeschichten. Als im Zuge des Zweiten Weltkrieges deutsche Familien innerhalb der Sowjetunion vertrieben wurden, aber auch als die Sowjetunion zusammenbrach und diese Familien erneut ihr Zuhause verlassen haben. Solche Erfahrungen können (transgenerationale) Traumata auslösen. „Die Jahre um 1991 waren für viele schwer und haben Leid und Schmerz ausgelöst. Unsere Eltern hatten wenig finanzielle Mittel. Diese Zeit kann sehr prägend und traumatisch gewesen sein. Wenn man sie nicht aufarbeitet, können sie an die Nachfahren weitergegeben werden”, erläutert der Psychologe Bohlender. Gerade jetzt könnten alte Sorgen aus den 90er Jahren hochkommen. Zum Beispiel die Angst, dass das eigene Weltbild erneut zusammenbricht und vieles, woran man geglaubt hat, für nichtig erklärt wird. Freunde erzählen, sie würden wieder schief angeguckt werden, wenn sie im Alltag russisch sprechen und in den Medien hört man von Firmen und Restaurants in Deutschland, die russische Staatsbürger:innen diskriminieren. Solche Nachrichten begünstigen ihre Sorgen.
Die älteren Generationen sind zudem in einem komplett anderen politischen und gesellschaftlichen System aufgewachsen: „Die Sozialisierung in Deutschland ist sehr individualistisch. Wir können frei und individuell über fast alles in unserem Leben entscheiden. Das steht der Sozialisierung unserer Eltern in der Sowjetunion gegenüber. Dort stand das kollektivistische Wohl über dem eigenen”, so Bohlender. Das erklärt, wieso Familienstreitigkeiten manchmal derart eskalieren. „Die Postost-Community erfüllt eine Art Hybridfunktion und muss die Konflikte der kollektiven und individualistischen Gesellschaft in sich selbst vereinen, was nicht immer einfach ist“, sagt Psychologe.

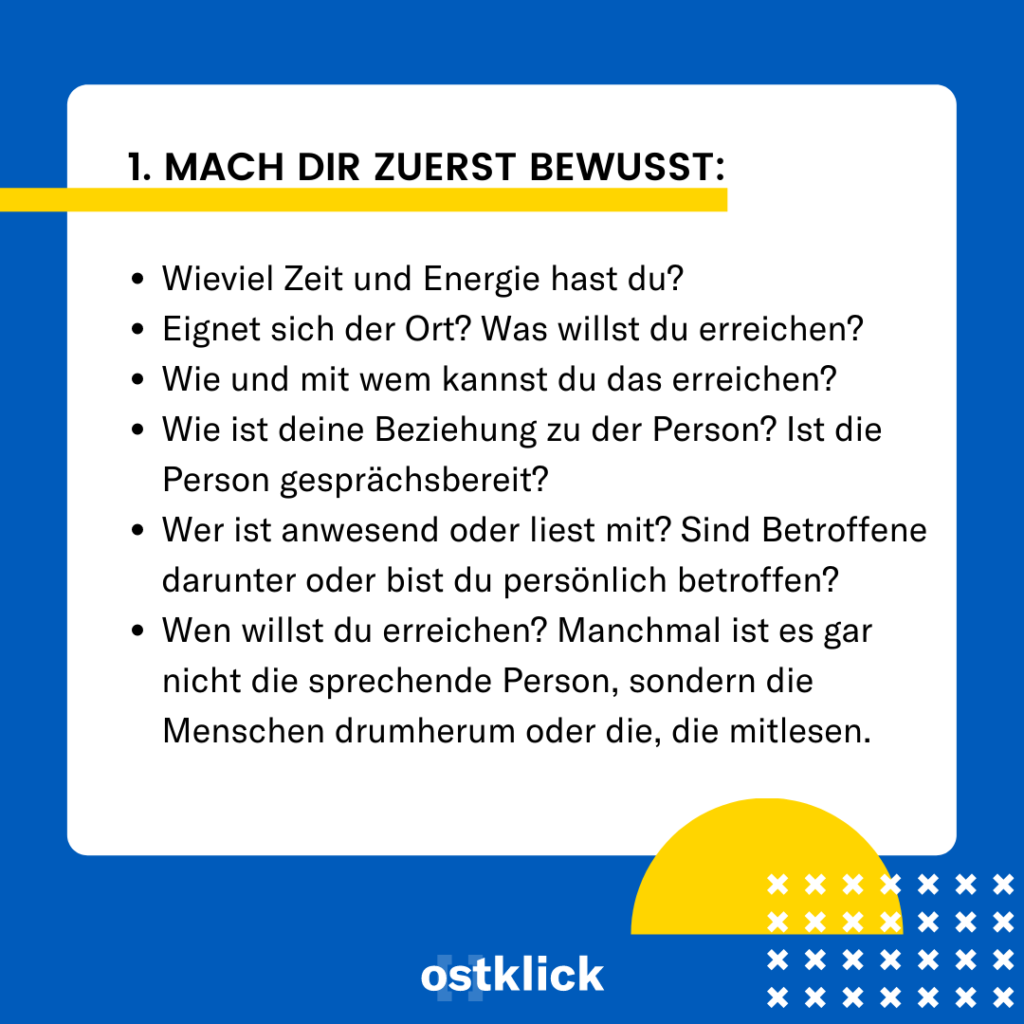




Ressourcen einteilen
„In Familien, in denen man gar nicht miteinander darüber sprechen kann, sollte man es sein lassen. Das tut weh, aber manchmal geht es nicht anders”, sagt Sergej Prokopkin. Tina hat schon vor einiger Zeit den Kontakt zu ihrer Schwester abgebrochen, nun fürchtet sie auch um die Beziehung zu ihrer Mutter: „Ich fühle mich tatsächlich seltsam und habe Angst, weil ich sie sehr liebe und nicht verlieren möchte.“
„Die Eskalation eines solchen Konflikts ist verständlich, weil man eigene Werte vertreten will und eine eigene ideologische Ausrichtung hat. So gehen aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen verloren und man konzentriert sich beim Streiten nur auf die Unterschiede”, so Bohlender. Bei einem Gespräch sollte man sich lieber auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Sie können uns dabei helfen, wieder zueinander zu finden, ohne die eigenen Prinzipien verwerfen zu müssen.
„Das sind meine Eltern und ich liebe sie von ganzem Herzen. Umgekehrt genauso. Ich folge dem Mantra ‚choose your battles‘. Wenn ich die Kraft habe, gebe ich Kontra. Wenn nicht, sage ich, dass ich jetzt nicht darüber sprechen möchte. Es ist nicht so, als würden wir uns momentan nur streiten, aber wir sind vorsichtiger miteinander. Für mich ist und bleibt meine Familie mein Anker und auch wenn es solche schweren Zeiten wie momentan gibt, die positiven Aspekte überwiegen die negativen bei Weitem“, sagt Kristina. Für sie ist der Kontaktabbruch keine Option.
Während man aus Liebe zu den Mamas, Papas, Omas und Opas zwar den Familienfrieden wahren möchte, will man auch nicht jede Propaganda-Lüge unbeantwortet lassen. Dieser Weg zwischen Familiensegen und Familienstreit scheint ein sehr schmaler Grat zu sein. Vor jeder Auseinandersetzung sollte man sich überlegen, ob man die Kraft dazu hat oder Ressourcen lieber aufspart. Denn bis man einen geeigneten Weg findet, werden wohl noch einige Familienessen stattfinden und Alarmglocken läuten.
–
Text: Erika Balzer
Foto: Garry Knight

















